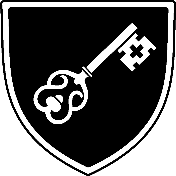Von Markus Steinbeis, geschäftsführender Gesellschafter der steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh
„Sell in May und go away“ ist wohl eine der bekanntesten Weiseiten an der Börse. Letztendlich beschreibt dieser Spruch eine Kapitalmarktanomalie, nach der die Renditen an den Aktienmärkten in den Monaten Mai bis September oft unterdurchschnittlich ausfallen. Könnte es dieses Jahr anders kommen? Aus unserer Sicht ja! War der Jahresbeginn an den Aktienmärkten noch von Euphorie vieler Anleger gekennzeichnet, ist nach den Kursrückschlägen im Frühjahr Ernüchterung eingekehrt. Als Konsequenz der dreimonatigen Korrekturphase besteht im Mai schlichtweg keine Möglichkeit für Investoren Gewinne mitzunehmen, denn die Volatilität ist 2018 nach langer Abstinenz wieder zurückgekehrt. Wir haben an dieser Stelle mehrmals erwähnt, dass wir eine größere Schwankungsbreite an den Aktienmärkten erwarten, spiegelt dies doch die Wiederaufnahme eines normalen Marktgeschehens wider. Letztlich darf eine höhere Volatilität nicht mit einer Veränderung der makroökonomischen Rahmenbedingungen oder der Fundamentaldaten von Unternehmen verwechselt werden. Unter Abwägung aller Chancen und Risiken können wir uns eine Erholungsbewegung an den Aktienmärkten in den kommenden Wochen und Monaten vorstellen. Dennoch haben wir die Risiken fest im Blick. Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen die für uns wichtigen Einflussfaktoren und Entwicklungen kurz vor.
Der Versuch der Notenbanken, dem Finanzsystem die „Droge“ Liquidität zu entziehen
Neben den Risiken eines zunehmenden Protektionismus (wir haben in der letzten Ausgabe des Marktberichts ausführlich dazu Stellung genommen) stellt der Versuch der wichtigen Notenbanken die Geldpolitik zu normalisieren einen bedeutenden Einflussfaktor für die Entwicklung der Kapitalmärkte in den kommenden Monaten dar. In einer hoffnungslos überschuldeten Welt ist Liquidität vergleichbar mit einer Droge. Wird sie reduziert oder gar entzogen, zeigen die Süchtigen Entzugserscheinungen. In einem bis dato nie vorstellbaren Ausmaß haben die Zentralbanken in den vergangenen Jahren in Reaktion auf die Finanzkrise die Wirtschaftssubjekte mit niedrigen Zinsen und Liquidität versorgt. Wir erleben derzeit den verzweifelten Versuch dieser sogenannten Währungshüter eine Art Normalisierung einzuleiten. Das ist in etwa so, als wolle man die Zahnpasta wieder in die Tube drücken. Diese Normalisierung wird aus unserer Sicht nie gelingen, dennoch ist davon auszugehen, dass die Akteure diesen Weg weiterverfolgen, bis eben die Entzugserscheinungen sichtbar werden. Genau das ist ein für uns wichtiges, wenn nicht das wichtigste, Risikoszenario. Wie weit sind die Notenbanken in Anbetracht der fragilen Situation bereit zu gehen? Sollten Investoren den Eindruck gewinnen, dass Jerome Powell, Mario Draghi und Co nicht mehr gewillt sind, die Aktienmärkte wie in der Vergangenheit zu stützen, stehen uns volatile Zeiten bevor.
An der Spitze der „Normalisierungsbewegung“ schreitet derzeit die US-Notenbank (FED). Sie erhöht die kurzfristigen Zinsen. Zusätzlich reduziert sie ihr Anleihe-Portfolio und damit ihre Bilanz. Beide Maßnahmen haben einen wachstumsdämpfenden Effekt auf die Wirtschaft, die sich im Vergleich zu früheren Aufschwüngen eh nur ungewöhnlich langsam und anämisch erholt hat. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) möchte diesen Pfad, wenn auch langsamer und vorsichtiger, beschreiten. Dazu hat sie ihre monatlichen Wertpapierkäufe von anfangs 80 Milliarden Euro sukzessive auf erst 60 Milliarden Euro und seit Beginn des Jahres auf 30 Milliarden Euro reduziert. Gegen Jahresende sollen die Käufe dann komplett eingestellt werden.
Damit wir uns nicht falsch verstehen: Wir begrüßen jegliche Entwicklung zurück zu einer normalen Zins- und Geldpolitik, wie wir Sie bis 2007 kannten. Nur fehlt uns der Glaube, ja wir halten es gar für ausgeschlossen, dass wir derartige Zeiten wieder erleben werden. Die Staatsschulden der Euroländer betragen etwa 10 Billionen Euro. Ein Zinsanstieg von nur einem Prozent würde die jährlichen Zinskosten um 100 Milliarden Euro erhöhen. Eine Illusion zu glauben, dass eine Normalisierung in den kommenden Jahren erreichbar wäre. Die Drogensüchtigen brauchen weiter Liquidität – in Zukunft sogar wahrscheinlich mehr davon.
Sind Wachstumssorgen angebracht?
Es wird immer offensichtlicher, dass der Aufschwung der Weltwirtschaft seinen Höhepunkt erreicht hat. Das Wachstum ist zwar weiterhin robust, allerdings deutet mittlerweile vieles auf eine Abschwächung in der zweiten Jahreshälfte hin. Dadurch geraten die ungelösten strukturellen Probleme wieder in den Vordergrund, vor allem die hohe Verschuldung und das in weiten Teilen niedrige Produktivitätswachstum. Auch im Euroraum fallen die Frühindikatoren seit Monaten. So zeigt der Einkaufsmanagerindex für die Industrie deutlich nach unten und kündigt damit eine nachhaltige Stimmungseintrübung an. Auch der Trend des deutschen Ifo-Geschäftsklimaindex zeigt nach unten. Wachstumsdellen in langanhaltenden Aufschwungphasen sind zwar nichts Außergewöhnliches, müssen jedoch vor dem Hintergrund der Gesamtsituation genau beobachtet werden, denn auch die ersten offiziellen Konjunkturdaten für das erste Quartal zeigen in die gleiche Richtung. So hat sich in Frankreich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts bereits von 0,7 auf 0,3 Prozent reduziert.
Wenn auch gegenwärtig noch nicht ersichtlich, könnten uns ähnliche Signale in Kürze auch aus den USA erreichen. Zwar wirken die fiskalischen Impulse der Steuerreform und der hohen Staatsausgaben noch positiv, aber die Anzeichen auf eine Wachstumsverlangsamung könnten bald sichtbar werden. Es würde uns nicht wundern, wenn der deutliche Zinsanstieg in Kombination mit einem massiven Anziehen der Ölpreise und den Sorgen vor Protektionismus bald erste Bremsspuren verursacht. Sollte der US-Dollar seine jüngst begonnene Aufschwungphase noch verstetigen, wäre der unangenehme Cocktail komplett.
Noch zeigen sich die meisten Marktbeobachter ob dieser Entwicklung unbeeindruckt. Auch wir sind noch weit davon entfernt, von den Risiken einer Rezession zu sprechen. Dennoch verlassen wir uns nicht darauf, dass die derzeit noch allgegenwärtigen optimistischen Konjunkturprognosen auch Realität werden. Es mehren sich einfach die Anzeichen, dass die Erwartungshaltung vieler Investoren bezüglich des globalen Wachstums in diesem Jahr enttäuscht wird. Damit wäre auch der Grundstein für eine wieder expansivere Geldpolitik seitens der Notenbanken gelegt.
Der Anstieg der US-Zinsen dürfte sich zunächst dem Ende nähern
Die Zinsentwicklung in den USA stellt für uns eine der wichtigsten Stellschrauben für die mittelfristige Entwicklung an den Kapitalmärkten dar. Der deutliche Anstieg der Renditen seit letztem Sommer könnte sich vor dem Hintergrund potenzieller Konjunkturenttäuschungen in den kommenden Wochen dem Ende nähern. Der Zins für zweijährige US-Staatsanleihen beispielsweise erhöhte sich seit dieser Zeit von 1,3 auf 2,5 Prozent.
Wir bezweifeln, dass der Zinsanstieg der vergangenen Monate vordergründig auf erhöhte langfristige Inflationserwartungen zurückzuführen ist. Demnach müsste sich die US-Zinsstrukturkurve steiler präsentieren. Das Gegenteil ist der Fall: Die Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinsen wurde jüngst immer geringer – auch ein Indiz für Konjunkturskepsis. Wir gehen davon aus, dass wir uns insbesondere bei den längeren Laufzeiten auf attraktiven Kaufniveaus für US-Anleihen befinden. Zinssätze im zehnjährigen Laufzeitenbereich von etwa 3 Prozent könnten auf mittlere Sicht attraktive Investments sein, zumal auch der US-Dollar gegenüber dem Euro weiteres Aufwertungspotential besitzt. Die hohe Differenz zwischen US- und Euro-Zinsen,
das Ausbleiben von Inflation in Euroland, die noch etwas robustere Verfassung der US-Konjunktur und eine noch deutliche Überinvestition großer Anleger im Euro sprechen mittelfristig für den Greenback. Ein Ende des Zinsanstiegs, vielleicht sogar ein leichter Rückgang der US-Renditen ist eine der Grundvoraussetzungen für eine Renaissance des Aktienmarktes. Die Chancen für eine derartige Entwicklung stehen in den kommenden Wochen gut.
Risikofaktor Erdöl
Erstmal vorbei sind die Zeiten billigen Erdöls. Als die Preise für die Sorte WTI beginnend im dritten Quartal 2014 von 90 US-Dollar bis auf unter 40 US-Dollar am Jahresanfang 2016 gefallen waren, wurden Stimmen laut, die den Untergang eines Rohstoffs und der damit verbundenen Industrie in Kürze vorhersagten. Die erhöhte Fördertätigkeit in den USA, Disziplinlosigkeit bei der OPEC und der Niedergang der Verbrennungsmotoren beim Automobil würden die Preise weiter deutlich drücken. Was für eine Fehlanalyse. Der Ölpreis notiert mittlerweile wieder auf einem dreieinhalb Jahreshoch und die internationalen Ölkonzerne sind wieder auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Was ist seitdem geschehen?
Zunächst zeigt der Blick auf die Nachfrageseite ein weiterhin sehr positives Bild. Die weltweite Gier nach Öl ist weiterhin ungebrochen. So hat China im April 9 Millionen Barrel (ein Barrel entspricht 159 Liter) pro Tag importiert – ein neuer Rekordstand. Die Sorge liegt eindeutig auf der Angebotsseite. Hier sind die Geopolitik und die mangelnde Bereitschaft für Investitionen zu nennen.
Derzeit ist der Ölmarkt unterversorgt. Die politischen Probleme beim OPEC-Mitglied Venezuela haben dort zu einem dramatischen Rückgang der Ölproduktion geführt. Im März produzierte das südamerikanische Land nur noch 1,5 Millionen Barrel pro Tag. Damit fördert die OPEC derzeit etwa 500.000 Barrel pro Tag weniger als vom Markt benötigt. Frei verfügbare Kapazitäten anderer OPEC-Mitglieder scheinen begrenzt. Auch die US-Shale-Öl-Industrie ist unter anderem aufgrund mangelnder Infrastruktur derzeit nicht in der Lage die Lücke zu schließen. Derweil tut sich neues Ungemach auf: Die USA können es nicht lassen und zündeln erneut im Nahen Osten. Präsident Trump will am 12. Mai entscheiden, ob er das Iran-Atomabkommen aufkündigt. Vieles deutet darauf hin, dass er dies tun wird. Dadurch sollte sich der schon angespannte Ölmarkt weiter verknappen.
Mittelfristig problematisch könnte die mangelnde Investitionsbereitschaft der Ölunternehmen werden. Investoren sind vorsichtig geworden. Würde der Verbrennungsmotor wirklich sukzessive vom Elektroantrieb ersetzt, würde das einen dramatischen Nachfragerückgang zur Folge haben. Insofern ist die Zurückhaltung beim Erschließen neuer Ölvorkommen verständlich. Da dieser Substitutionsprozess aber extrem langsam verläuft, besteht die Gefahr, dass aufgrund fehlender neuer Ölvorkommen die Angebotsseite zwischenzeitlich weiter unter Druck gerät und die Ölpreise überschießen. Kein unrealistisches Szenario mit deutlichen Auswirkungen auf Wirtschaftswachstum und Inflationsraten.
Fazit: Der Optimismus könnte in den kommenden Wochen an die Aktienmärkte zurückkehren
Ein Ende des Zinsanstiegs, temporäre Entspannungstendenzen bei den Handelskonflikten und ein Ausbleiben geopolitischer Risiken könnten den Weg für steigende Aktienkurse in den kommenden Wochen ebnen. Bei europäischen Aktien dürfte ein Ende der Euro-Aufwertung für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Uns ist es wichtig, trotz aller mittelfristigen Zuversicht, die Risiken im Auge zu behalten. Mit dem Liquiditätsentzug der Notenbanken, der konjunkturellen Abkühlung und der Situation im Ölmarkt haben wir in dieser Ausgabe drei wichtige Risikofaktoren beschrieben, die wir sehr genau beobachten. Aber getreu unserem Motto „Vermögen bewahren und Chancen nutzen“ liegt der Fokus in den kommenden Wochen mehr bei den Chancen.
Wie schon in unserer letzten Ausgabe angedeutet, erwarten wir aber einen Favoritenwechsel an den internationalen Aktienmärkten. So dürften unglaublich hoch bewertete Unternehmen aus den Wachstumsbereichen wie Technologie kaum mehr in der Lage sein, die Führungsrolle zu übernehmen. In einer Phase abnehmender konjunktureller Dynamik könnten solide Qualitätsunternehmen aus defensiven Bereichen wie Pharma und Nahrungsmittel eine Renaissance erleben.
© steinbeis & häcker vermögensverwaltung gmbh. Alle Rechte vorbehalten.